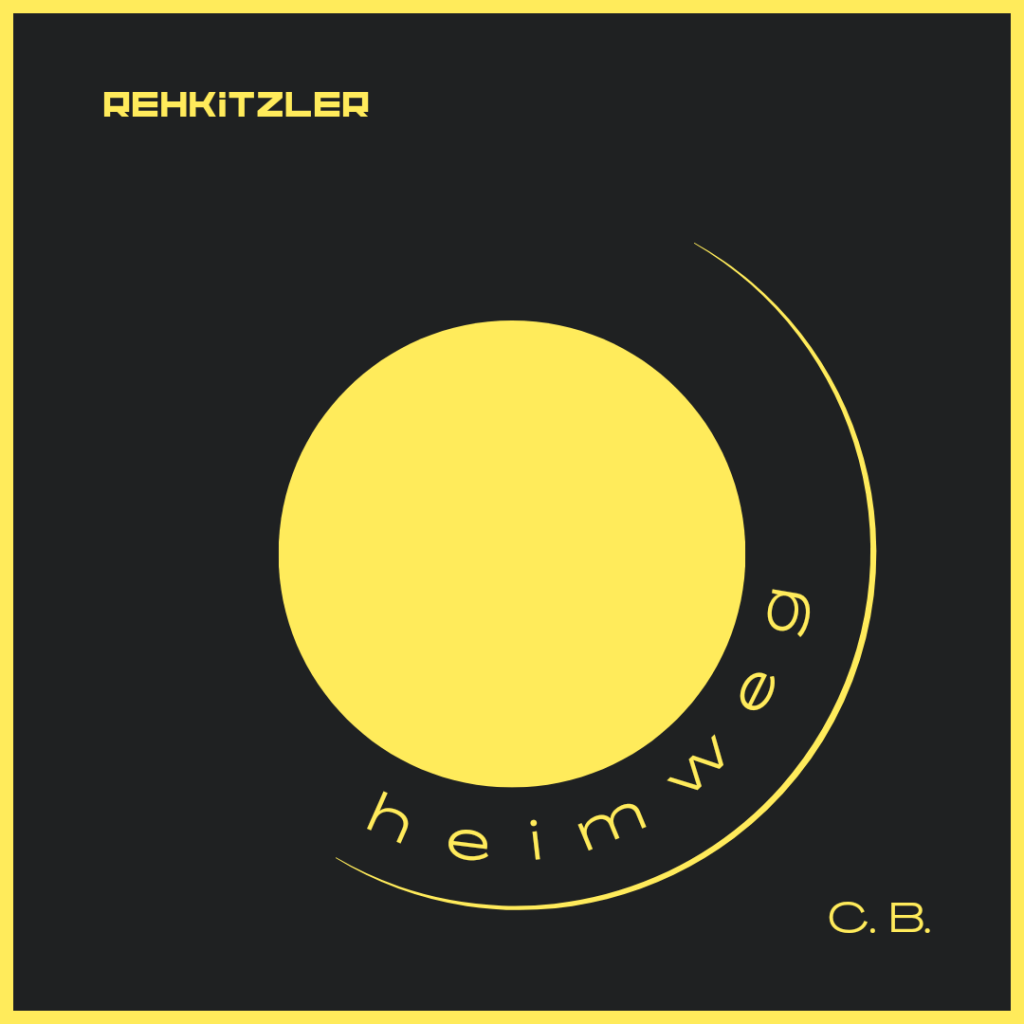von C. B.
Auf dem Heimweg nachts von Bar, Gesellschaft und Liebe sieht meine vertraute Stadt mich mit anderen Augen. Da wo zu anderen Zeiten Tageslicht hinfällt, schaffen blinkende Straßenlaternen es nicht, auf herkömmlichen Wegen wahrzunehmen. Wenn ich durch die halbdunklen Wege schleiche, traue ich mich hin und wieder einen schnellen, kurzen Blick in die vorüberziehenden Fenster zu werfen. Ein Blinken eines Blicks, ein Blicken während eines Blinks.
Außerhalb der Lichter, ein Sich-Treiben-Lassen durch die Dunkelheit. Nichts als Glück, dass kein Blick mich streift, keine Idee mir näher kommt. Durch die dunklen Fenster niemand, der mich ansieht, dunkle Gestalten, die Menschen zwar ähneln, aber nur Möbelstücke, Pflanzen, höchstens Schatten sind.
Doch eine Gestalt bewegt sich. Ich zucke zusammen. Ein Hund bellt. Er kann zwar nicht lesen, aber ich verberge mich schnell in der undurchblickten Dunkelheit, unbehelligt von Blicken duckend unter dem blickenden Streif. Um sicherzugehen, dass er meine Fährte nicht aufnimmt, steige ich ganz in den See aus Schwarz, streife meine Klamotten ab, um gänzlich unerkannt zu sein und stoße mich mit den Füßen vom Straßenrand ab.
Fast lautlos schwimme ich die Wege bis zu meinem Haus entlang, halte inne, halte den Kopf nach oben, um über der Dunkelheit Luft zu holen. Eine Straßenlaterne blickt auf mich hinab. Ich raste nicht weiter, tauche hinab, um diesem Blink zu entkommen. Wärme umschließt meine Haut, dunkel erinnere ich mich an Blicke, erblicke Dunkel.
Meine Beine streift schließlich ein Streif von Licht. Zuhause angekommen streife ich die Dunkelheit ab und platziere sie als Decke zusammengelegt auf dem Sofa. Wenn der Winter erst einmal da ist, werde ich sie gut gebrauchen können.